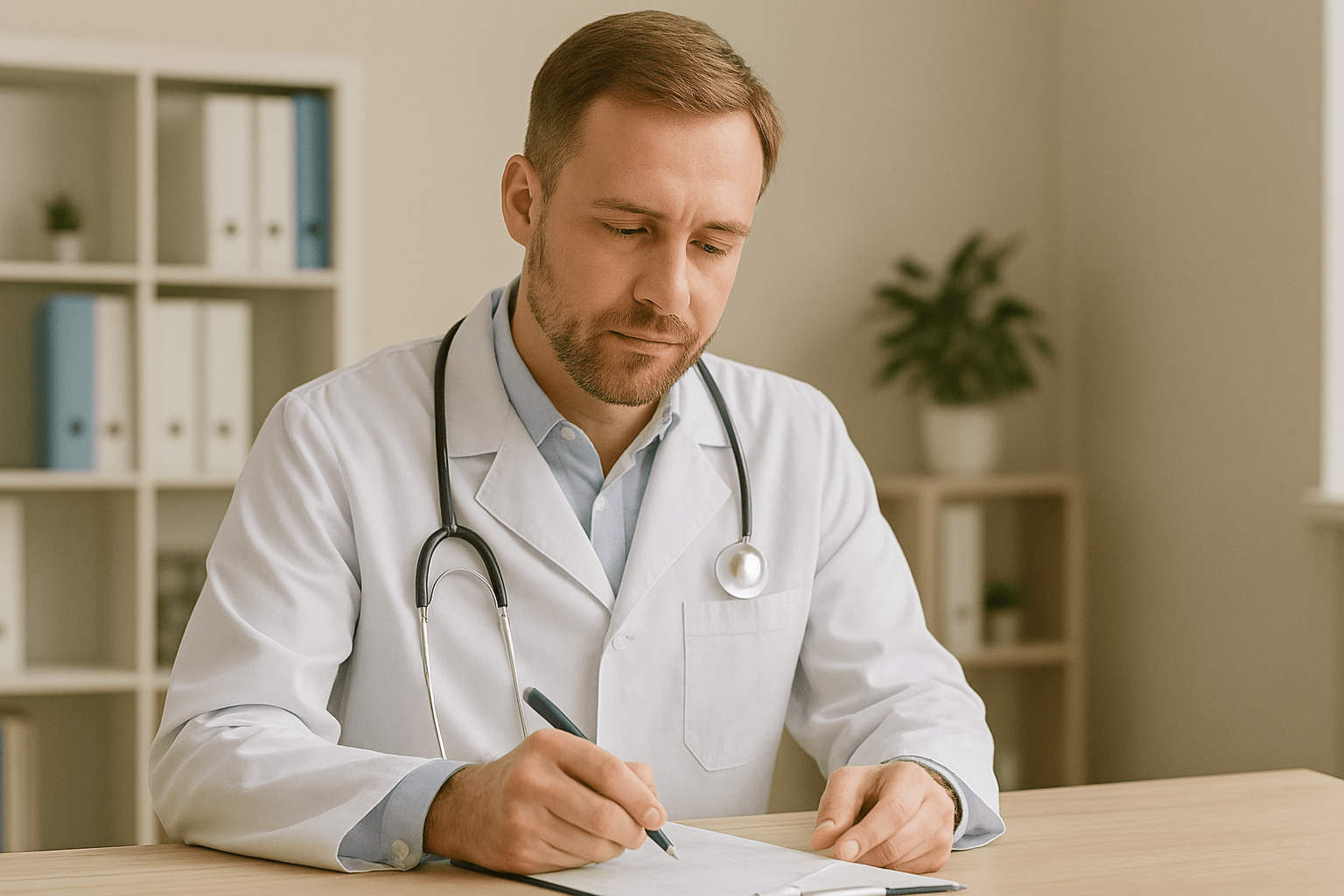Die medizinische Versorgung befindet sich in einem fundamentalen Wandel. Chronische Erkrankungen, psychische Belastungen, Rehabilitation und Lebensstilinterventionen erfordern zunehmend kontinuierliche Unterstützung jenseits des klassischen Praxisbesuchs. Digitale Gesundheitsanwendungen – kurz DiGA – schließen hier eine Versorgungslücke. Sie sind entwickelt, um Patientinnen und Patienten strukturiert durch den Alltag zu begleiten, Therapieadhärenz zu verbessern und die Eigenkompetenz zu stärken – mit ärztlicher Führung und klarer Evidenzbasis.
Deutschland ist weltweit Vorreiter: Seit der gesetzlichen Verankerung 2019 sind DiGA regulär verordnungsfähig und von der Krankenkasse erstattungsfähig. Mittlerweile sind über 60 Anwendungen gelistet – vom Schmerzmanagement bis zur Unterstützung bei psychischen Erkrankungen, von der Adipositastherapie bis zur Nachsorge onkologischer Patienten. Der Fokus liegt auf Erkrankungen, die im Alltag hohe Belastung erzeugen und bei denen eine kontinuierliche, strukturierte Begleitung den Therapieerfolg messbar verbessert.
Zugelassen werden DiGA über ein zweistufiges Prüfverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Anwendungen können vorläufig aufgenommen werden, wenn erste Evidenz vorliegt und der Versorgungseffekt in laufenden Studien nachgewiesen wird. Spätestens nach zwölf Monaten muss die klinische Wirksamkeit abschließend belegt sein, um eine dauerhafte Aufnahme zu erhalten. Das Ergebnis: ein Versorgungsinstrument mit nachgewiesenem medizinischem oder strukturellen Nutzen und klar definierten Qualitäts- und Datenschutzstandards.
Damit stehen Ärzten und Therapeuten heute Anwendungen zur Verfügung, die mehr sind als Lifestyle-Apps. Es handelt sich um Medizinprodukte, rechtlich abgesichert, evidenzbasiert und in die Versorgung integriert.
Einordnung und rechtlicher Rahmen
Digitale Gesundheitsanwendungen sind nicht einfach digitale Begleiter, sondern regulierte Medizinprodukte der Risikoklasse I oder IIa nach § 33a SGB V. Sie werden in einem definierten Prüfverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet. Dieses Verfahren prüft nicht nur technische Sicherheit und Datenschutz, sondern verlangt einen nachgewiesenen positiven Versorgungseffekt (pVE). Dieser Effekt kann entweder einen direkten medizinischen Nutzen belegen, etwa eine messbare Symptomverbesserung oder Funktionssteigerung, oder eine strukturverbessernde Wirkung, beispielsweise die Steigerung der Therapieadhärenz oder die Optimierung von Versorgungsprozessen.
Für die ärztliche Praxis bedeutet das: Jede DiGA, die verordnet wird, ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, rechtlich abgesichert, evidenzbasiert und von den gesetzlichen Krankenkassen erstattungsfähig. Hier geht es nicht um Lifestyle-Apps, sondern um ein Instrument der Regelversorgung.
Ärztliche Indikationsstellung und Verordnung
Die Einbindung digitaler Anwendungen folgt denselben medizinischen Grundsätzen wie jede andere Therapieentscheidung: Indikationsstellung, Nutzen-Risiko-Abwägung und Einbettung in das individuelle Behandlungskonzept. Entscheidend sind drei Faktoren: die klinische Diagnose, die Therapiezieldefinition und die Patientenvoraussetzungen wie Motivation und digitale Kompetenz.
Die Verordnung erfolgt auf dem bekannten Muster 16, analog zu Arzneimitteln und Heilmitteln. Nach Genehmigung durch die Krankenkasse erhalten Patienten einen Freischaltcode, mit dem sie die Anwendung aktivieren und sofort nutzen können. Die Therapie findet überwiegend in Eigenanwendung statt, bleibt aber ärztlich begleitet. Damit wird das, was im Sprechzimmer initiiert wird, im Alltag fortgesetzt – strukturiert, dokumentiert und rechtssicher.
Klinischer Nutzen und Patienteneinbindung
DiGA erweitern den Behandlungsraum. Patienten können Übungen, edukative Module oder Monitoringfunktionen nutzen, die sich nahtlos in ihren Alltag integrieren lassen. Damit wird Therapie zu einem kontinuierlichen Prozess und nicht zu einem punktuellen Ereignis im Behandlungszimmer.
Für Ärzte ergeben sich zwei entscheidende Vorteile: Erstens wird die Therapieadhärenz gesteigert, weil Patienten aktiv eingebunden und regelmäßig erinnert werden. Zweitens liefern viele Anwendungen strukturierte Rückmeldungen – von Selbsteinschätzungen bis zu Verlaufsdaten –, die eine objektivere Beurteilung des Therapieerfolgs ermöglichen. Entscheidungen basieren damit nicht allein auf Momentaufnahmen, sondern auf kontinuierlichen, alltagsnahen Daten.
Besonders deutlich wird das bei chronischen Erkrankungen, psychischen Belastungen und Lebensstilinterventionen. Therapien, die bisher an mangelnder Alltagsintegration oder Motivation scheiterten, erhalten durch digitale Unterstützung eine belastbare Basis..
Implementierung in den Praxisworkflow
Die Integration in den Praxisalltag erfordert zunächst Klarheit: Wie wird aufgeklärt, wer verordnet, wie wird die Nachsorge strukturiert? Diese Fragen lassen sich meist schnell beantworten. Erfahrungsgemäß reicht es, einen klar definierten Ablauf festzulegen: Indikation und Zieldefinition beim Erstkontakt, Verordnung und kurze Einführung in die Nutzung, gefolgt von einer Nachkontrolle mit Ergebnisbesprechung.
Ein Nebeneffekt: Verlaufsgespräche werden fokussierter. Patienten kommen vorbereitet, mit dokumentierten Daten und konkreten Fragen. Das reduziert repetitive Beratungsanteile und ermöglicht ein Arbeiten auf höherem Niveau – strategisch, zielgerichtet und patientenzentriert.
Chancen und Herausforderungen
Der größte Gewinn liegt in einer verstärkten Patientenbeteiligung. Patienten werden von passiven Empfängern zu aktiven Partnern ihrer Therapie. Für Ärzte bedeutet das mehr Datenqualität und eine stabilere Adhärenz. Gleichzeitig eröffnen sich Möglichkeiten, Versorgungslücken zu schließen – insbesondere in Phasen zwischen den Terminen oder bei limitierten Praxisressourcen.
Natürlich gibt es Herausforderungen: Nicht jeder Patient ist sofort digitalaffin, und Praxen müssen Abläufe anfangs anpassen. Doch die Erfahrung zeigt, dass diese Hürden schnell überwunden werden. Sobald erste Patienten erfolgreich begleitet werden, wird die digitale Unterstützung selbstverständlich und integraler Bestandteil des Praxisalltags.
Fazit – DiGA sind ein ärztliches Werkzeug, kein
Fremdkörper
Digitale Gesundheitsanwendungen ersetzen keine ärztliche Expertise. Sie erweitern sie. Sie geben uns die Möglichkeit, Therapieziele nachhaltiger umzusetzen, Patienten stärker einzubinden und Behandlungsergebnisse datenbasiert zu begleiten. Ihre rechtliche Basis ist geklärt, der klinische Nutzen nachgewiesen, die Verordnung unkompliziert.
Genau hier setzt goDiGA an: Wir übernehmen die patientenbezogenen Prozesse, die sonst Zeit und Ressourcen in der Praxis binden würden. Vom strukturierten Zugang über die Hilfestellung bei der Aktivierung bis hin zur begleitenden Information des Patienten kümmern wir uns um die Umsetzung – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die ärztliche Therapieentscheidung und die Betreuung Ihrer Patienten.
goDiGA liefert nicht nur eine Plattform, sondern einen vollständigen Service, der digitale Anwendungen in der Praxis alltagstauglich macht. Das bedeutet weniger organisatorische Reibung, schnellere Patientenwege und mehr Sicherheit im Einsatz digitaler Therapieunterstützung.
Digitale Medizin ist kein Zukunftsprojekt mehr – sie ist bereits Teil der ärztlichen Routine. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob wir digitale Anwendungen nutzen, sondern wie aktiv wir ihre Integration gestalten wollen. Mit goDiGA steht dafür eine Lösung bereit, die die digitale Versorgung strukturiert, sicher und praxisnah macht.
Weiterdenken. Weiter begleiten. Weiter wirken.
Bleiben Sie informiert.
Der goDiGA Concierge liefert Ihnen nicht nur kompakte Updates zu neuen DiGA, aktuellen Studienlagen, Fortbildungsterminen und Praxistipps – er unterstützt Sie auch beim Onboarding und begleitet Sie Schritt für Schritt in die digitale Versorgung.
Mehr erfahren
Finden Sie die passende DiGA – einfach und strukturiert.
Der DiGA-Kompass für Fachkreise zeigt Ihnen alle aktuell gelisteten DiGA – filterbar nach Indikation, Fachgebiet und Anwendung. Kein Durchsuchen, kein Rätselraten. Nur Orientierung – so, wie sie im Praxisalltag wirklich hilft.
Zum DiGA-Kompass
Vertiefen Sie Ihr Wissen. Praxisnah, ärztlich, fundiert.
In unserer goDiGA Fachinfo beleuchten wir aktuelle Entwicklungen, zeigen echte Fallbeispiele und helfen, digitale Medizin sinnvoll zu integrieren – nicht abstrakt, sondern anwendbar.
Zur goDiGA Fachinfo
Let’s go DiGA.